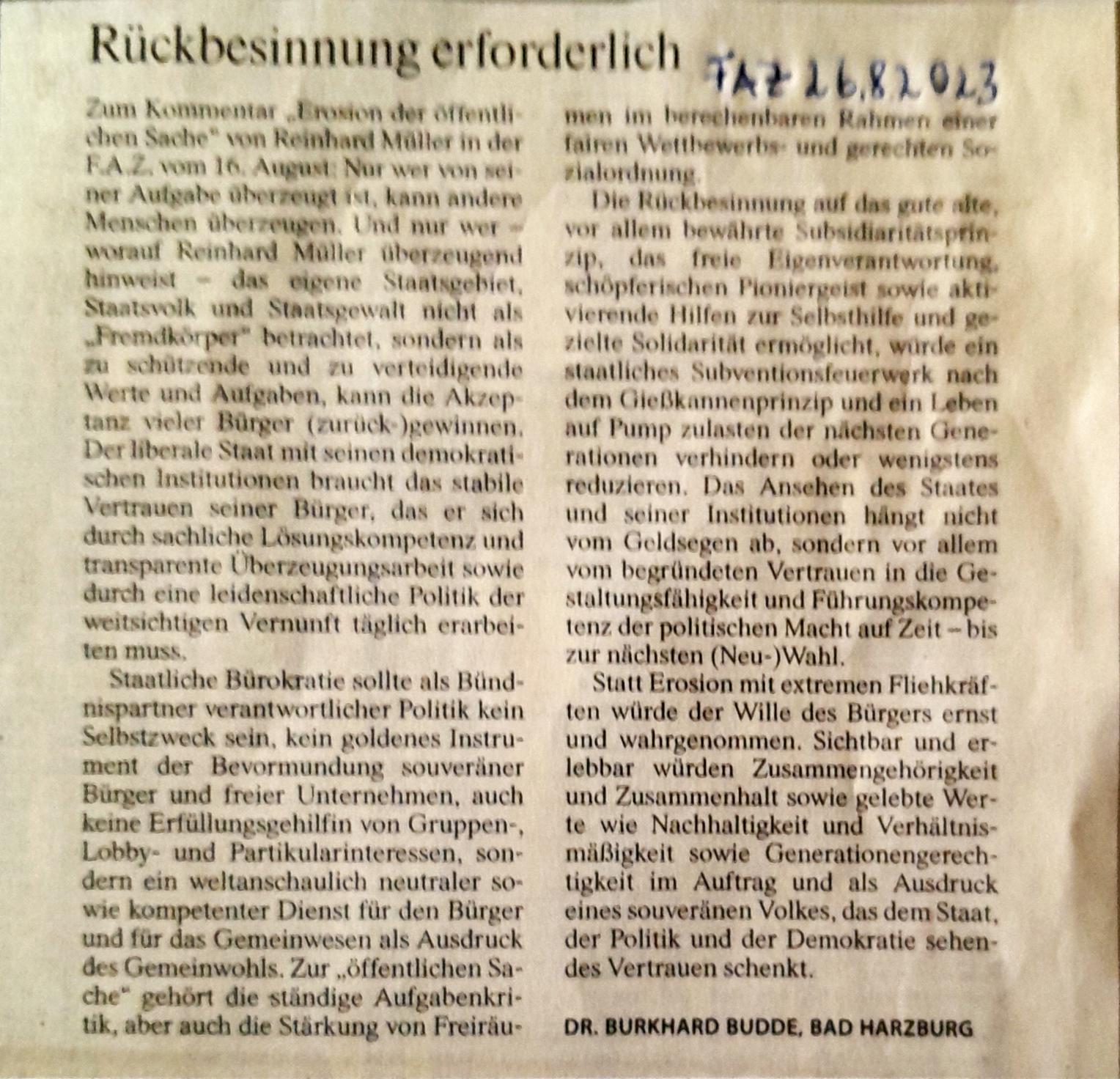Erstes Gebot
Moment mal
Lebensperspektiven
Von Burkhard Budde

Zehn Lebensperspektiven
(Erstes Gebot)
Zehn Lebensperspektiven begründen das Zusammenleben, stärken den Zusammenhalt und erneuern das Zusammenbleiben: Die Zehn Gebote gehören zur einheits- und sinnstiftenden Schatzkammer von Juden und Christen. Sie sind jedoch auch eine Einladung an Andersdenkende, in den Raum des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe einzutreten, um neue Entdeckungen sammeln zu können – vielleicht auch ein glückseliges Leben in der letzten Geborgenheit bei Gott und in der Verantwortung vor Gott und dem Nächsten.
Die erste Perspektive in jüdischer Lesart lautet:
Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat.
Gott als Herrn und Befreier aus Ägypten anerkennen?
Eine mögliche Antwort ist:
Weil Gott will, dass Menschen ihm als zuverlässigen Wegbereiter vertrauen.
Dein Leben wird beseelt, gewinnt Sinn und Liebe, wenn Gott dich von den Fesseln entwürdigender Abhängigkeiten befreit. Gott will dich durch Täler und über Höhen begleiten. Er bietet dir seine unsichtbare, aber erfahrbare Gemeinschaft an. Er schenkt dir Orientierung und Schutz, Mut und Zuversicht sowie Kraft und Möglichkeiten zum Weitergehen in den weiten Raum neuen Lebens.
Aber wie kann ich diesen Gott wann und wo in meinem Leben erfahren?
Im stillen Gebet im stillen Kämmerlein? Im Gottesdienst in einer Kirche im Hören auf Gottes Wort oder in der singenden Gemeinschaft? In der kritischen Auseinandersetzung in der Schule über Gottes- und Menschenbilder? Im meditativen Nachdenken in der freien Natur über den Schöpfer und die Schöpfung sowie über seine Geschöpfe und seinen Willen? Im Erleben christlicher Werte wie Nächstenliebe und Zivilcourage am Arbeitsplatz oder an anderen Orten? Oder auch beim Lesen eines Denkanstoßes oder einer Andacht in einer Zeitung?
Menschen, so biblische Berichte, die in ihrer geistigen und seelischen Obdachlosigkeit oder in ihren sozialen und körperlichen Ketten die Begegnung mit dem lebendigen Gott der biblischen Geschichte aufrichtig suchen, werden von Gott selbst mit seiner begleitenden Gegenwart beschenkt.
Damalige und heutige Menschen, die offen sind für solche Erfahrungen, können die Gewissheit der befreienden und versöhnenden göttlichen Nähe nicht machen oder erklären, nicht herbeizaubern oder beweisen, da das Geschöpf nicht Schöpfer ist und Gott frei und souverän bleibt. Wohl aber kann das menschliche Abbild des göttlichen Urbildes die Geburt des Ruhens in Gott erleben, einen Lichtstrahl des ewigen Friedens in der Dunkelheit des menschlichen Unfriedens. Dieses Geheimnis eines Gottsuchenden und Gottvertrauenden bleibt ein persönliches Erlebnis, weil Gott viele Möglichkeiten kennt, Menschen zu begegnen.
Gläubige jedoch, die sich zu Gott als ihren Herrn und Befreier in Wort und Tat bekennen, müssen keine Schwärmer oder Moralisten werden, keine Supermenschen oder Sondermenschen. Denn in ihrer freiwilligen Bindung an den Willen des lebendigen Gottes verfügen sie über keine Fesseln, mit denen sie andere bevormunden oder erziehen, das selbstständige und unabhängige Denken und Handeln verhindern wollen. Die von Gott Befreiten können vielmehr der Freiheit anderer in Würde, Liebe und Verantwortung vor Gott und dem Nächsten weiten Raum geben.
Fortsetzung folgt.
Burkhard Budde
Veröffentlicht in der Kolumne „Auf ein Wort“ des Wolfenbütteler Schaufensters am 17.9. 2023