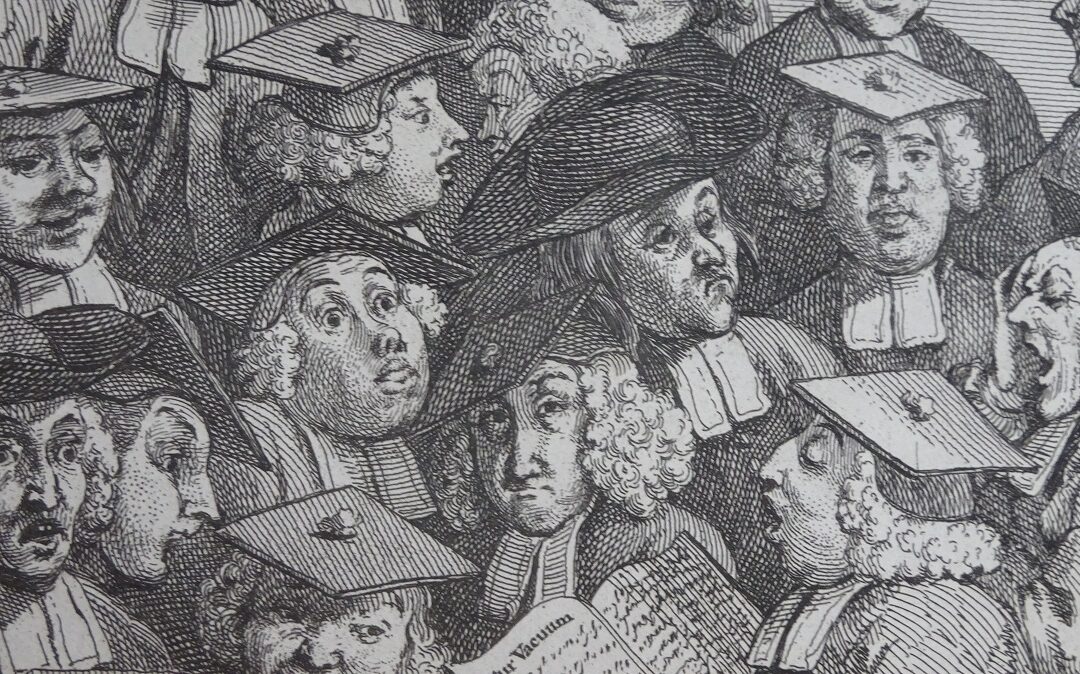Frust adieu
Moment mal
Frust adieu
Von Burkhard Budde

Sarah Connor in ihrem Video beim Song „Bye,Bye“.
Was tun, wenn Frust statt Lust herrscht? Wenn die Decke wegen Einsamkeit auf den Kopf fällt? Der Kragen wegen Verletzungen platzt? Das Vertrauen wegen Enttäuschungen bröckelt? Das Gefühl der Sinnlosigkeit wegen vergeblicher Liebesmüh aufs Gemüt drückt? Der Akku der Seele sich leert, obwohl man nichts tut? Und die Seele schmerzhaft knirscht, wenn man etwas tut? Die Kraft, die im Verzicht liegt, sich langsam verzehrt? Dann braucht wohl jeder frustrierte Mensch ein Ventil.
Sarah Connor, 40-jährige Popsängerin, scheint mit ihrem Song „By, Bye“, der im Dezember 2020 veröffentlicht wurde, ein solches Ventil gefunden zu haben, um ihren Corona-Frust loszuwerden. Sie schildert in ihrer Single zunächst ihre Situation – ihre Trostlosigkeit („nichts zu tun“), ihr Gefühl der Sinnlosigkeit („kein’n Sinn“), ihre innere Zerrissenheit („okay, aber ne, eigentlich nicht“), ihr Genervtsein („keine Lust mehr“).
Aber dann bewegt sie sich im Liedrefrain vorsichtig fragend durchs „Vorspulen“ und „Tun, als wär alles wieder gut“ in eine Zukunft mit alten und jungen Freunden. In ihrer Wunschwelt wird wie früher „‘ne fette Party“ gefeiert – ohne Isolation und Kontaktlosigkeit. Und sie verrät ihren Lieblingstraum, „dass du mich weckst und sagst, „Es ist vorbei!“ Bye-bye, bye-bye.“
Wer hätte da nicht Verständnis, wenn ein frustrierter Mensch in eine Kristallkugel schaut, träumt, vor allem sich Luft macht, da seine Pläne durchkreuzt wurden, seine Seele unverschuldet verletzt, er zum Verzicht sowie zur Gemeinschafts- und Körperlosigkeit gezwungen wurde? Sarah Connor scheut sich nicht, Klartext zu sprechen: „Der ganze Scheiß mit dem Abstand. Ich will nur zurück nach Island. Ich will Nähe und Spaß. Und mit dir trinken aus demselben Glas.“
Wer würde jetzt jedoch nicht nachdenklich: Auch wenn heftiges Träumen erlaubt sein muss, weil Musik nicht nur ein Ventil ist, um Frust rauszulassen, sondern auch Medizin, die versucht, Frust zu überwinden. Aber kann das, was einmal war, einfach wiederholt oder wiederhergestellt werden?
Der Harfenspieler David aus dem Alten Testament hat mit seiner Musik König Saul von seiner „Schwermut“ befreit. Und noch heute bewegen und trösten seine Psalmen Menschen, die anschließend ihre Verantwortung vor Gott und ihrer Mitwelt wahrnehmen: Indem sie aus Einsicht nötigen Abstand halten, um auf Dauer Nähe zu ermöglichen. Aus Weitsicht vorsichtig sind, um eigenes und fremdes Leben zu schützen. Und indem sie aus dem Glauben heraus – da man Ängste, Verletzungen bei Gott im Gebet loswerden kann – dem Frust adieu (übersetzt „zu Gott“) sagen. Um neue frohmachende Wege gehen zu können.
Burkhard Budde
Veröffentlicht im Westfalen-Blatt in Ostwestfalen und Lippe
in der Kolumne „Moment mal“ am 6.3.2021
sowie im Wolfenbütteler Schaufenster
am 7.3.2021