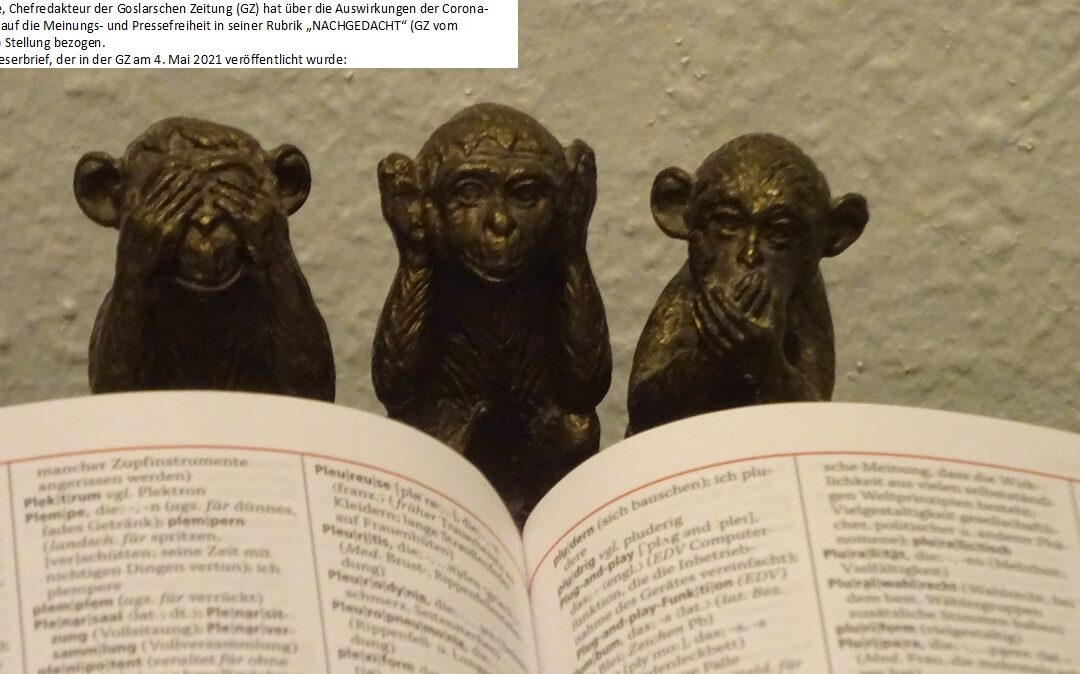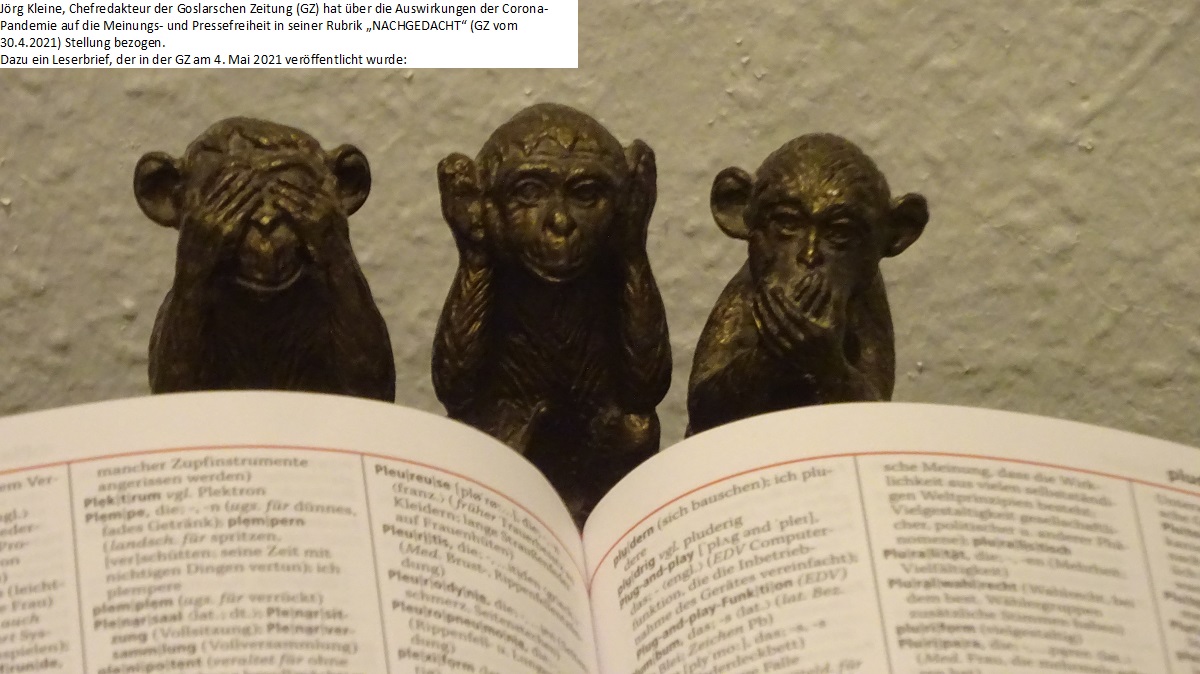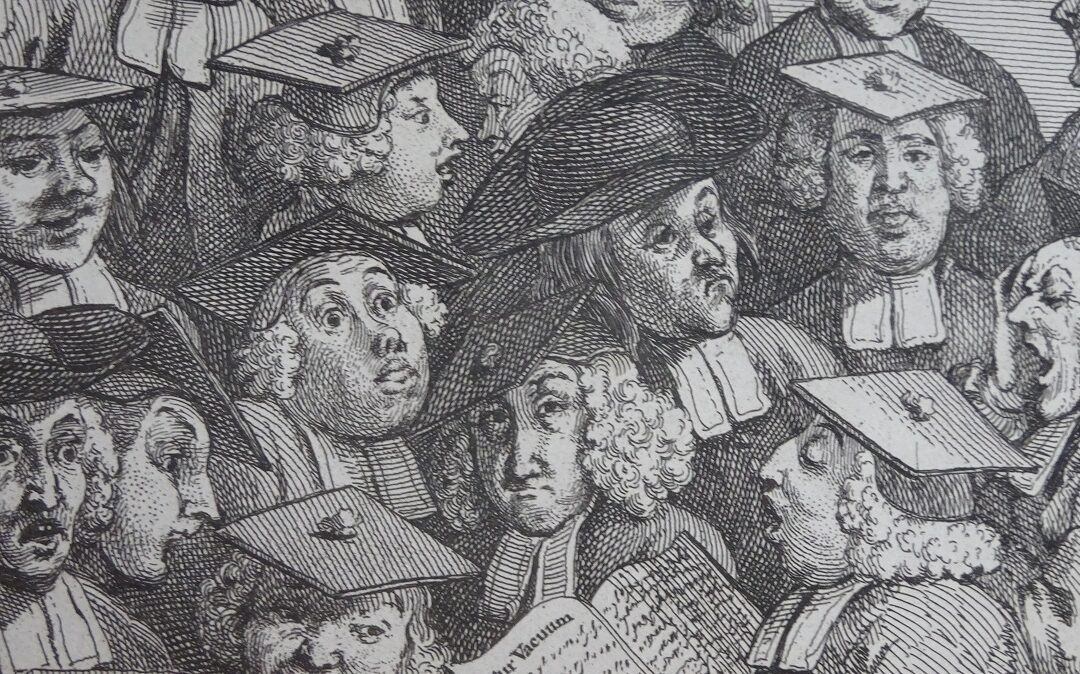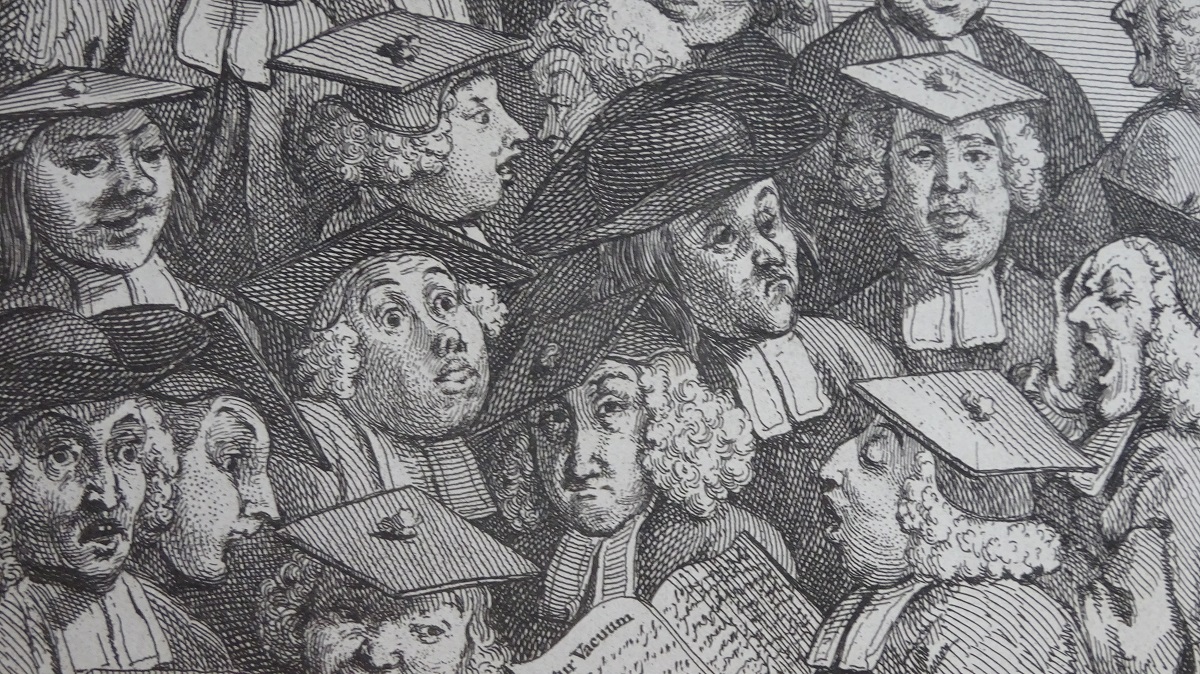Muttertag
Moment mal
Muttertag
Von Burkhard Budde

Familie am Muttertag unterwegs
Mehr wissen – besser verstehen
Mütter achten und ehren
Zum Namen:
Der Muttertag am 2. Maisonntag erinnert an besondere Frauen, an eine Feministin und Frauen der Frauenbewegung, aber auch an die Lebensleistung der eigenen Mutter sowie an alle Frauen, die sich für ein soziales Miteinander und Versöhnung einsetzen.
Zur Geschichte:
Anna Jarvis (1864-1948), eine unverheiratete und kinderlose Lehrerin und Tochter eines Methodisten Pfarrers aus West Virginia, setzte sich für politische Ziele der Frauenbewegung wie das Frauenwahlrecht ein.
Als ihre ebenfalls politisch aktive Mutter am 9. Mai 1905 starb, warb sie für ein jährliches Gedenken an die Lebensleistung ihrer Mutter, die 1858 „Mother`s Work Days“ für den Kampf gegen hohe Kindersterblichkeit und für bessere sanitäre Anlagen gegründet hatte.
Mit dem ersten Muttertag 1908 – Anna Jaris verteilte nach einem Gottesdienst 500 Nelken, die Lieblingsblume der Mutter – sollte an die „Werke aller Mütter“ gedacht werden, besonders an die soziale und politische Rolle von Frauen in der Gesellschaft. Der Muttertag sollte ein Gedenktag sein, kein Geschenktag.
1914 wurde der Muttertag zum amerikanischen Feiertag erklärt (die Mütter Amerikas als „zärtliche Armee“).
Ab 1922 engagierte sich der Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber für die Feier zu Ehren „der stillen Heldinnen unseres Volkes“.
1933 wurde der Muttertag von den Nationalsozialisten mit ihrem NS-Mutterkult missbraucht (für „Führer, Volk und Vaterland“ Kinder bekommen).
Nach 1945 wurde der Muttertag zunächst abgeschafft; in den fünfziger Jahren in der Bundesrepublik wiederbelebt.
Zur Bedeutung:
Als Gedenktag ist der Muttertag für viele Menschen zugleich ein Tag des Dankes sowie der Ehrung im Blick auf das Lebenswerk der eigenen Mutter. Dieser Dank kann zum Beispiel besonders begründet sein, wenn eine Mutter nicht nur an die eigene Karriere und nicht nur an die des Kindes gedacht hat, sondern zugleich und vor allem an die Förderung der individuellen Persönlichkeitsentwicklung ihres Kindes:
Wenn Mutter und Vater mit Hilfe eines ethischen Kompasses wie Verantwortung und Mitmenschlichkeit sowie im Wissen um Sinn- und Kraftquellen die Erziehung ihres Kindes gemeinsam ernst- und wahrnehmen konnten.
Wenn sie ihre Lebenszeit teilten, auf Ego-Trips verzichteten und bei der Bewältigung von Problemen mit gutem Beispiel vorangegangen sind sowie geholfen haben, dass das Kind immer selbstständiger und eigenverantwortlicher werden konnte.
Der Muttertag kann darüber hinaus auch zum Versöhnungstag werden, wenn keine Noten verteilt werden wie „ungerechte Mutter“ oder „undankbares Kind“, auch keine Gefühle mit goldenen Worten vorgespielt werden, sondern von beiden Seiten Herz gezeigt wird, Verstehen, Verständnis und Verständigung eine Rolle spielen, um durch die wertschätzende Erinnerung an die gemeinsame Vergangenheit eine gemeinsame Zukunft zu gewinnen.
Die Mutter bleibt für ein Kind stets eine Identifikations- und Leitfigur, die zur eigenen Reifung und zur eigenen Mündigkeit beiträgt, weil in jeder Mutter mit widersprüchlichen Mütterbildern eine Frau steckt – mit weiblichen Spezifika, menschlichen Ambivalenzen, sozialen Spannungen sowie mit individuellen Anziehungs- und Ausstrahlungskräften, eben ein einmaliger und unverwechselbarer Mensch mit einer unverlierbaren Würde.
Burkhard Budde
Veröffentlicht auch im Wolfenbütteler Schaufenster am 9.5.2021