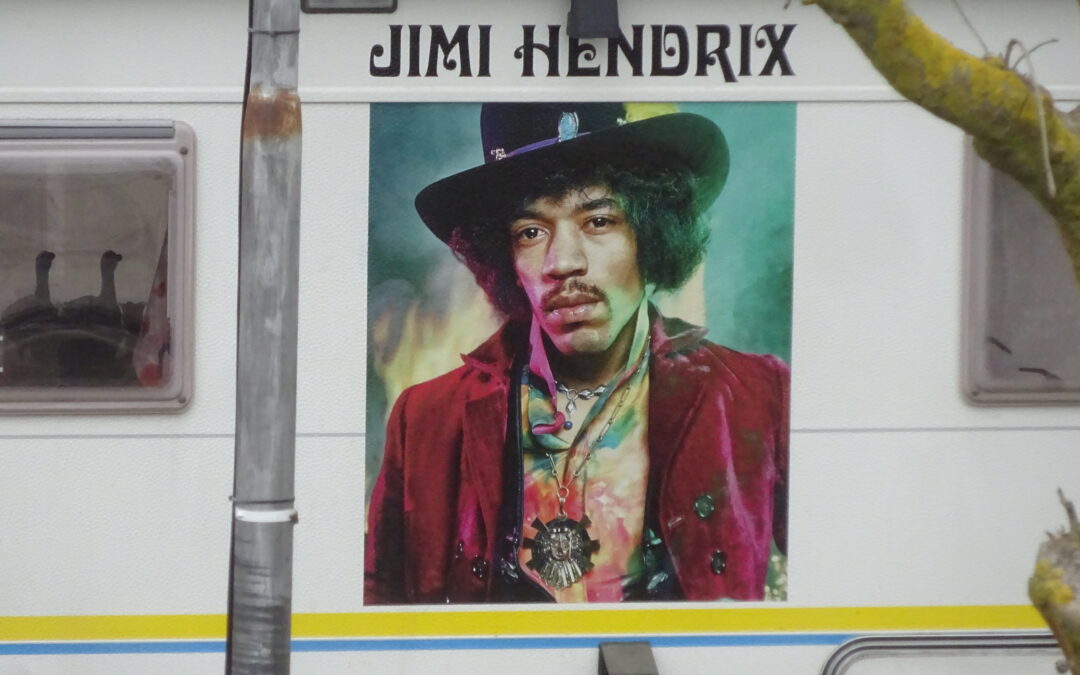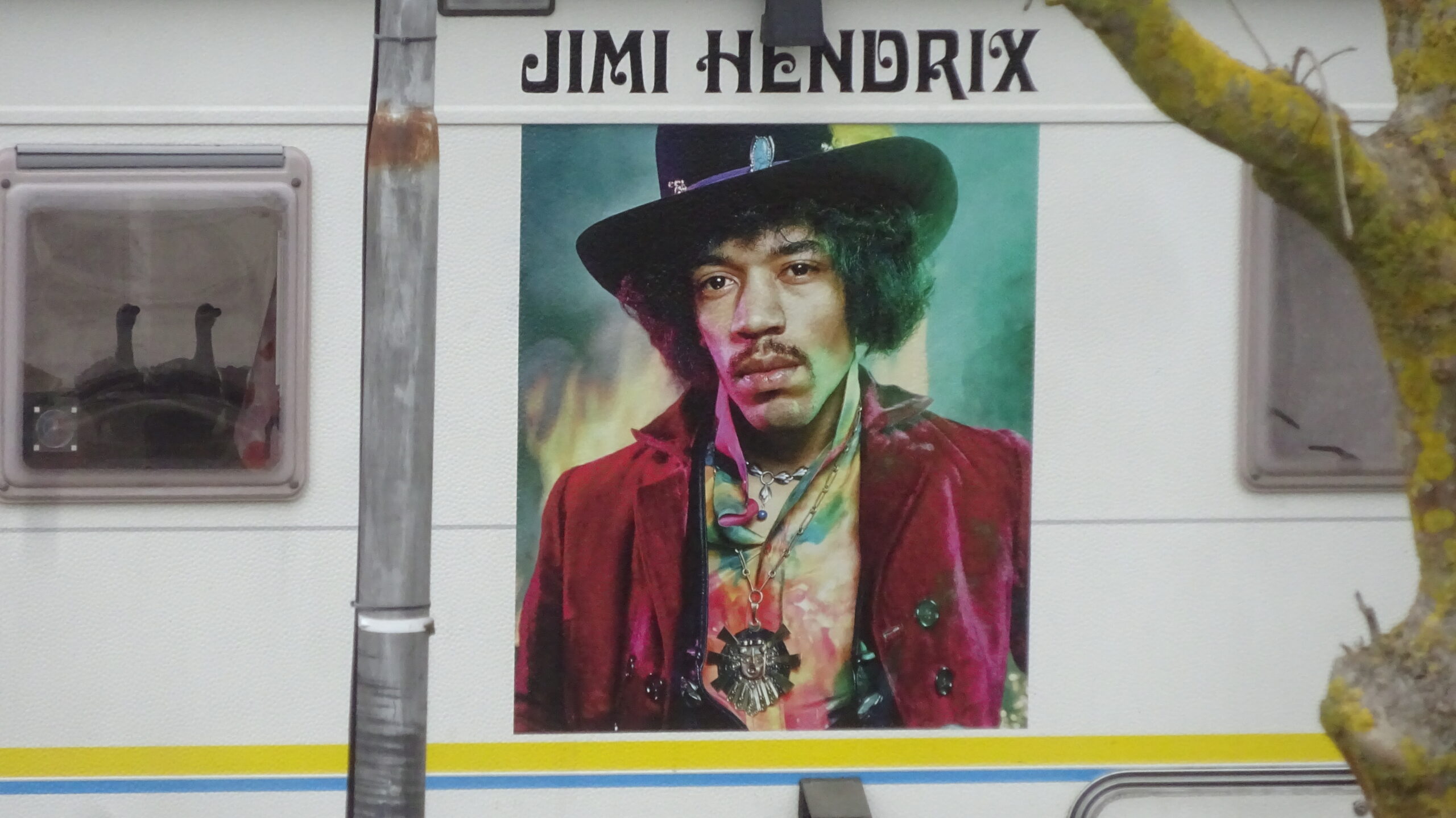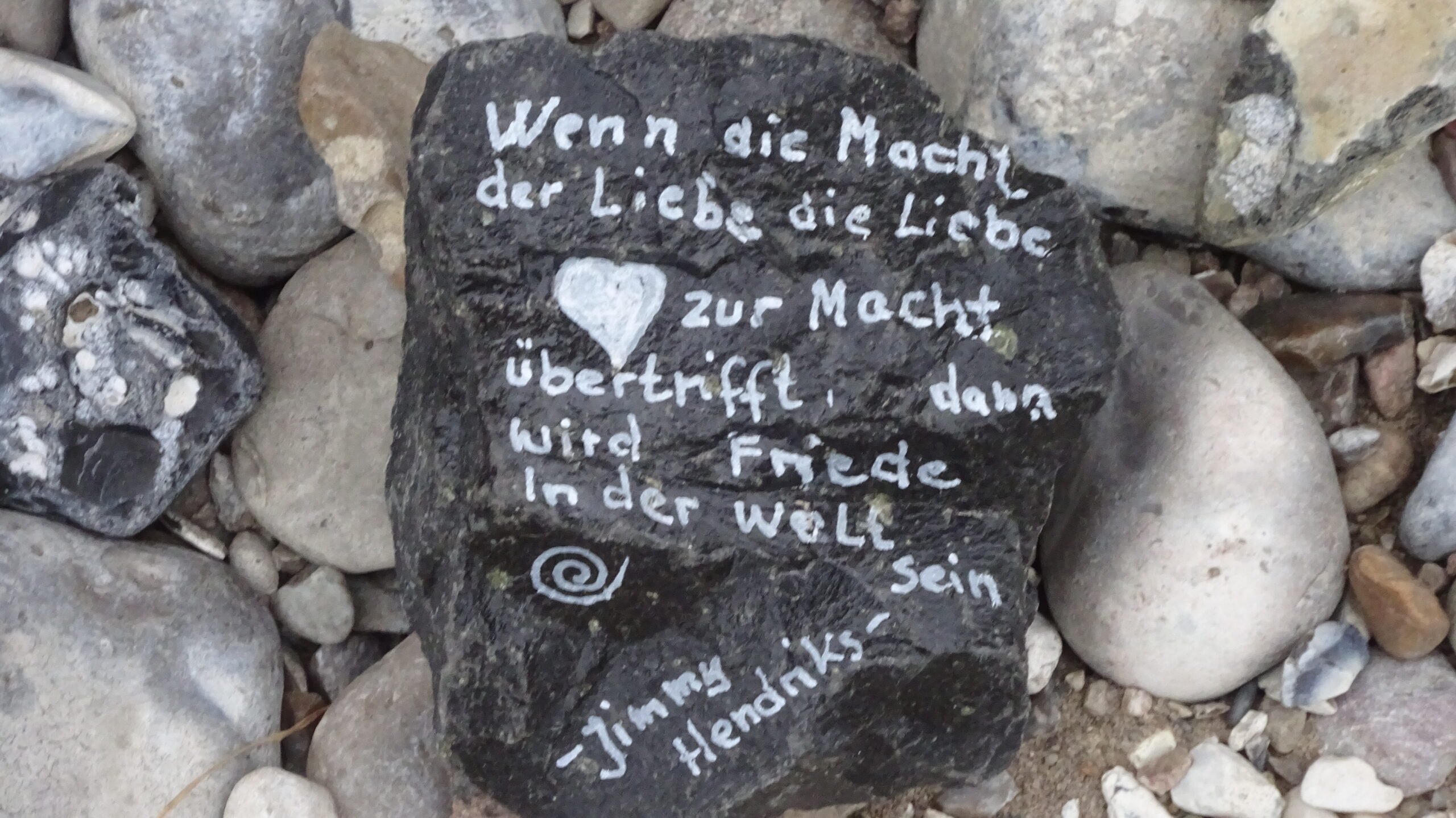Frohe Ostern
Moment mal
Frohe Ostern
Von Burkhard Budde

Mitten im Leiden und angesichts des Todes ein frohes und gesegnetes Osterfest wünschend
Frohe Ostern
Mehr wissen – besser verstehen
Ereignis neuen Lebens
Ostern, das älteste christliche Fest sowie das Hauptfest des Kirchenjahres, wird als Fest der Auferstehung Jesu am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond gefeiert.
Zum Namen: Es gibt offene Fragen: Stammt der Name von einem altgermanischen Frühlingsfest ab? Wurde dieses Fest in vorchristlicher Zeit im ersten Frühlingsmonat zu Ehren der Licht- und Frühlingsgöttin mit Namen „Eostra“ gefeiert (altgermanisch „austro“, lateinisch „aurora“ = „die Morgenröte“)? Und im Zuge der Christianisierung mit dem christlichen Fest in Verbindung gebracht, weil das leere Grab Jesu „früh am Morgen, als eben die Sonne aufging“ (Markus 16,2) entdeckt worden war und später sich viele neue Christen „bei Sonnenaufgang“ am Ostermorgen taufen ließen?
Zum Ursprung: Zunächst wurde das Gedächtnis der Auferstehung Jesu jeden Sonntag am „Tag der Auferstehung Jesu“ gefeiert. In der jüdischen Pessachwoche – mit der Erinnerung an die Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei – hatte Jesus, selbst Jude, mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl am 14. Nisan gefeiert. Es war der jüdische Rüsttag zum Passahfest mit Schlachtung der Lämmer (später wurde der Tag von den Christen „Gründonnerstag“ genannt, Tag der Einsetzung des Abendmahles). Einen Tag später war Jesus gestorben („Karfreitag“); er wurde begraben („Karsamstag“ als Tag der Grabesruhe) und bei Anbruch der neuen Woche, am „Ostersonntag“, am „dritten Tag gemäß der Schrift“, von den Toten auferweckt. (vergleiche 1.Kor 15,3-4). Zudem war Jesus am Abend des ersten Tages der Woche auch einigen seiner Jünger erschienen.
Zur Geschichte: Zur Jahresfeier entwickelte sich Ostern wohl im Zusammenhang mit dem jüdischen Pessach- oder Passahfest, das jährlich am 14. Nisan (= Monat im jüdischen Kalender) begangen wurde. Christen deuteten es offensichtlich als christliches Passahfest um: Christus – im Kontext seines Sühnetodes – wurde zum „Passahlamm“ (1.Kor.5, 7). Und in ihrer Eucharistiefeier vergegenwärtigten sich die Christen zugleich die Botschaft des christlichen Sonntages, die Auferstehung Jesu.
Seit dem 2. Jahrhundert – die Erwartung der Wiederkunft Christi, die „Parusie“, hatte nachgelassen – wurde Ostern in Rom als rein heidenchristliches Fest am Sonntag nach dem 14. Nisan gefeiert: Eine Osternachtfeier („Ostervigil“) mit u.a. Eucharistiefeier, Entzünden der Osterkerze, Taufen der Katchumenen gehörte dazu. Vorangegangen war eine (Vor-)Fastenzeit mit Karwoche; es folgte eine Freudenzeit mit Himmelfahrtsfest und dem Pfingstfest als Abschluss.
Christen in Kleinasien und Syrien feierten jedoch weiterhin Ostern am 14. Nisan. Das Konzil zu Nicäa im Jahre 325 fand in der strittigen Terminfrage einen Kompromiss: Einheitlich wurde Ostern auf den 1. Sonntag nach dem 1. Frühlingsvollmond gelegt, also frühestens am 22. März, spätestens am 25. April.
Zur Bedeutung: Ostern kann für Christen die Wende sein: Die Gewissheit der siegreichen Auferstehung Jesu, die Neuschöpfung Gottes, verändert auch das eigene Leben. Sie schenkt Licht in der Finsternis, Hoffnung in der Ohnmacht und Liebe im Tal der Angst. Das Leben kann angesichts des Todes dennoch, trotz allem und wider den Augenschein, mit Sinn und Freude gefüllt werden – im vertrauensvollen Rückblick auf den auferstandenen Gekreuzigten und durch glaubwürdige Gegenwartszeugen als Ereignis neuen Lebens.
Burkhard Budde