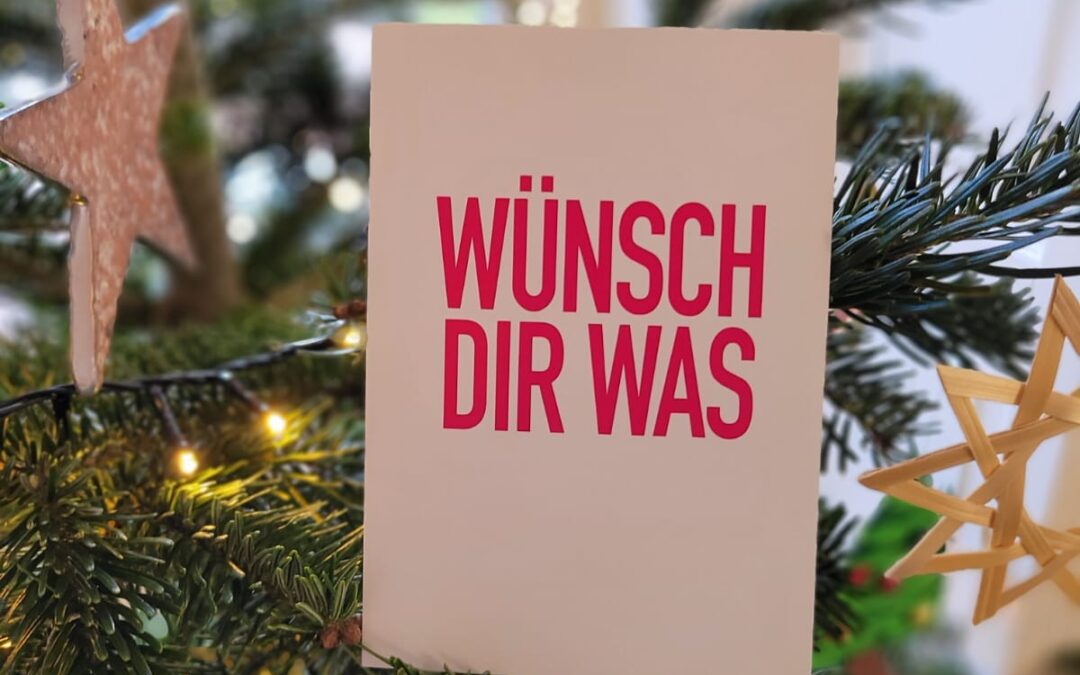Könige
Auf ein Wort
Augenweide mit Botschaft
Von Burkhard Budde

Auf ein Wort
Augenweide mit Botschaft
Beim Anblick sind sie eine Augenweide: Die prächtig und farbenfroh gekleideten Sternsinger, die jedes Jahr weltweit unterwegs sind – um den 6. Januar herum, dem Fest der Erscheinung des Herrn („Epiphanias“). Als Heilige Drei Könige verkleidet, tragen sie auf ihrem Kopf eine Krone oder eine Mitra, gehen singend von Haus zu Haus, sammeln mit ihrer Dose Spenden für Kinder in Not und bringen den Segen zu den Menschen. Mit Kreide schreiben sie an die Türen der Häuser das Dreikönigszeichen: C+M+B, eine Abkürzung für die Namen der Könige Caspar, Melchior, Balthasar oder für Christus mansionem benedicat, was übersetzt „Christus segne die Wohnung“ heißt.
Der Tag der Heiligen Drei Könige, der ab dem Mittelalter gefeiert wird, hat eine spannende Geschichte. Er erinnert zunächst an eine biblische Quelle, die allerdings nicht von Königen, sondern von „Weisen“ berichtet (Matthäus 2,1ff.). Die Astrologen aus dem Morgenland haben einen besonderen Stern gesehen, folgen ihm, um den neugeborenen „König der Juden“ zu finden, zu huldigen sowie mit Gold, Weihrauch und Myrrhe zu beschenken. Zunächst erfahren sie in Jerusalem Heuchelei, in Wahrheit Ablehnung und Aggression. Doch die zunächst durch den König Herodes Geblendeten und Irritierten schaffen es schließlich, in Bethlehem – auch mit Hilfe des Sterns – dem „wahren König“ zu begegnen. Als sie das Kind in der Krippe entdecken und anbeten, wächst in ihnen eine tiefe Freude: Auch für sie und allen anderen Menschen aus der nichtjüdischen Welt ist Jesus als der „Retter der Welt“ geboren!
Eine spätere Legende hat dann aus Sterndeuter „Könige“ gemacht und ihnen die königlichen Namen (siehe oben) gegeben, die – im 14. Jahrhundert – die drei damals bekannten Kontinente Europa, Asien und Afrika symbolisierten.
Im späten 3. und frühen 4. Jahrhundert wurden die Gebeine der Heiligen Drei Könige von der Mutter des Kaisers Konstantin, Helena, nach Konstantinopel gebracht; von dort führte der Weg der Reliquien nach Mailand und 1164 nach Köln. In der mit fast 50 000 Einwohnern die wohlhabendste Stadt des damaligen Reiches – sie war u.a. das Zentrum der deutschen Goldschmiedekunst -, entstand der Kölner Dreikönigsschrein mit 74 Figuren und über 1000 Edelsteinen, in dem die Reliquien aufbewahrt wurden.
Kaiser Otto IV, der 1218 auf der Harzburg – ein Machtzentrum und Rückzugsort für Otto IV – starb und in Braunschweig – dem (Schutz-) Zentrum der welfischen Macht – im Dom beigesetzt wurde, war nicht nur ein Förderer des goldenen Schreins. Der Sohn Heinrichs des Löwen verewigte sich auch als „Vierter König“ neben den Heiligen Drei Königen auf der goldenen Frontplatte des als dreischiffige Basilika geformten Kunstwerkes. Im Kölner Dom, der ab 1248 gebaut wurde und der den Drei Königen geweiht wurde, ist der einzigartige Schrein mit dem künstlerischen Hinweis auf eine geschichtliche Verbundenheit mit der Stadt Heinrichs des Löwen und dem Tor zum Oberharz noch heute zu sehen.
Aber zurück zu den heutigen Sternsingern. In diesem Jahr lautet ihr Motto „Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit“. Es ist ein politisches Motto, sich für Kinderrechte sowie für ihren Schutz und ihre Bildung zu engagieren. Wer ein Herz für Kinder hat, wird zum Beispiel auch nicht die Augen vor Gewalt gegen Kinder im Internet verschließen und den Datenschutz als Täterschutz missbrauchen lassen. Die christliche Botschaft von der Liebe Gottes zu allen Menschen, die jedem Einzelnen eine unverlierbare, unteilbare und unantastbare Würde schenkt, ist zugleich der ethische Kompass und die geistliche Kraftquelle, sich für die Schwachen und Wehrlosen einzusetzen, die keine Waren oder billige Arbeitskräfte, sondern von Gott geliebte sowie gewürdigte Könige mit eigenen Rechten sind.
Burkhard Budde