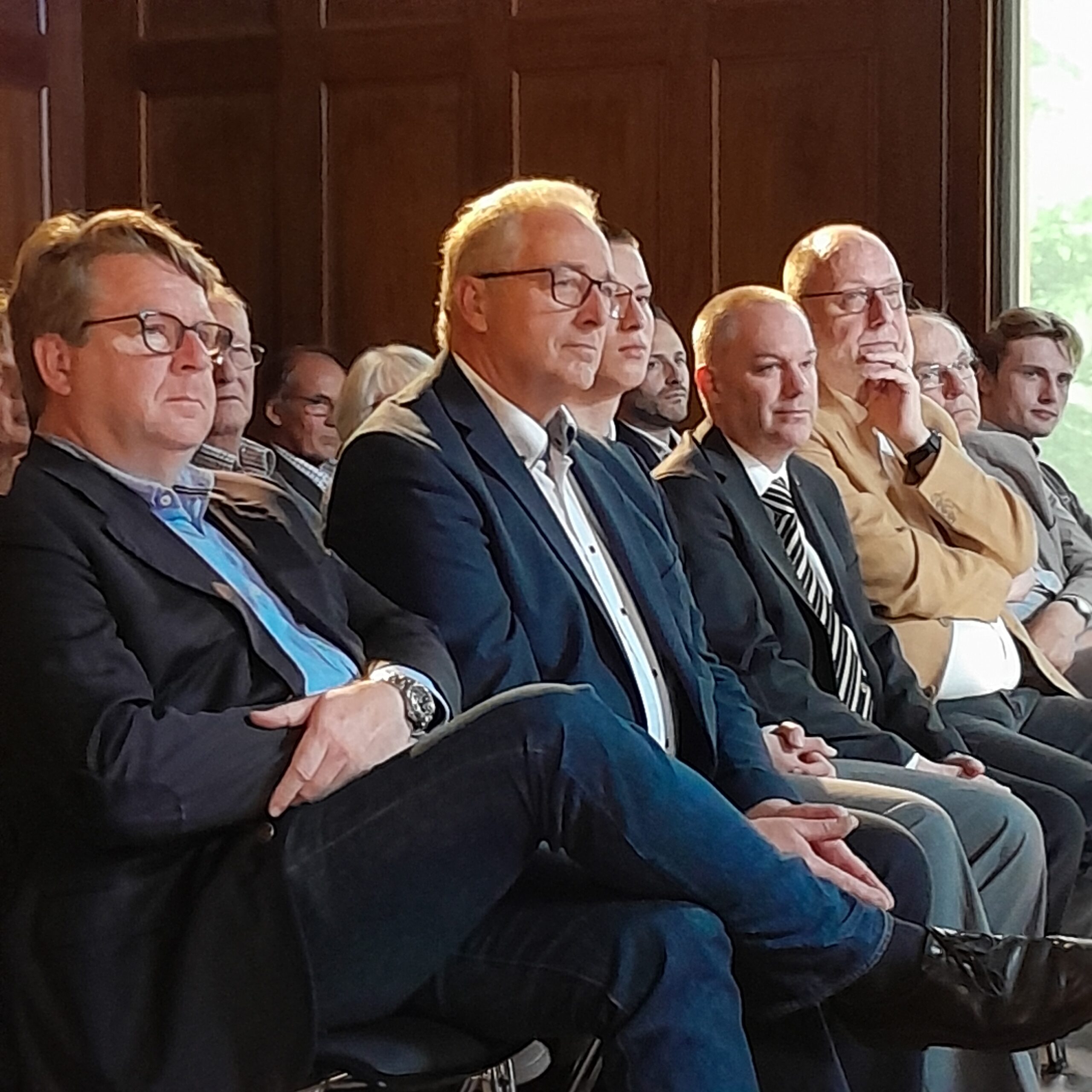Gute Gefühle
Auf ein Wort
Suche gute Gefühle
Von Burkhard Budde

Auf ein Wort
Suche gute Gefühle
Gefühle, schöne oder ungute, sind nicht zu unterschätzen. Häufig beeinflussen sie wichtige Entscheidungen im Leben: Welchem Partner das Ja-Wort gegeben oder welcher Beruf gewählt wird. Auch bei politischen Wahlen oder der Gestaltung der Freizeit geben Gefühle nicht selten den Ausschlag. Sie können auch Treiber sein, Widerstand zu leisten, wenn die Würde mit Füßen getreten wird oder Ungerechtigkeiten geschehen. Ohne die passende Filmmusik, die Gefühle weckt, hätte das Geschehen eines Filmes kein schlagendes Herz. Und auch in der Natur und Kultur, Kunst und Religion, im Vereins- oder Clubleben sind Gefühle Augen- und Türöffner für die Schönheit und Wahrheit, die Bedeutung eines Werkes oder die einer Gemeinschaft.
Gefühle sind treue Begleiter auf Schritt und Tritt. Als Botschafter der Seele sind sie wirkmächtig: Sie können Brücken bauen, aber auch einreißen, soziale Nähe ermöglichen, aber auch verhindern, vor Gefahren warnen, aber auch schaffen.
Aber kann ein Mensch Gefühle auch fühlen? Hat er vor allem seine Gefühle in Stress- und Konfliktsituationen stets im Griff, wenn sie im Porzellanbladen der Seele Purzelbäume schlagen – zum Beispiel beim Gefühl der Minderwertigkeit sowie der Angst, das Gesicht zu verlieren, nicht als Sieger vom Platz zu gehen? Oder bei neidischen, überheblichen, eiskalten Gefühlen? Bei feindseligen, boshaften, gehässigen, eifersüchtigen Gefühlen? Die alle wie ungebetene Gespenster hinter einer Ecke der Seele plötzlich auftauchen können?
Wie können zerstörerische Gefühle überwunden werden, ohne sie zu verdrängen, so dass sie im Untergrund ihr Unwesen treiben? Und wie können aufbauende Gefühle gestärkt werden, ohne dass sie sich zur Schwärmerei entwickeln und die Vernunft vernebeln?
Nur der Mensch, der gleichzeitig Wut und Schmetterlinge im Bau haben kann, ist in der Lage, eine Partnerschaft zwischen schnellen und spontanen Gefühlen und besonnenen und analytischen Gedanken zu schmieden. Wenn das wütende Gefühl sagt, „Räche dich, du bist verletzt worden, lass die Faust sprechen!“ hat der kluge Kopf eine Vetomöglichkeit, indem er sich an die Folgen erinnern lässt und nachdenklich fragt: „Gibt es nicht andere Lösungen, Probleme friedlich und nachhaltig zu lösen?“
Gefühle sind wahr- und ernst zu nehmen. Im Ringen sowie im Wechselspiel von Gefühlen und Vernunft kann es Gnade vor Recht geben, kann die Barmherzigkeit das letzte Wort haben. Doch wenn ein Gefühl die kritische und aufgeklärte Vernunft zerstören will, sollten alle Alarmglocken läuten. Denn Gefühle – eine Mischung aus prägender Lebensgeschichte und Kultur im Kontext einer konkreten Situation – können den inneren Kompass der persönlichen Verantwortung in Freiheit und Würde nicht ersetzen.
Manchmal jedoch erleben Menschen eine Situation, in denen sowohl das kämpferische Gefühl als auch die kämpferische Vernunft mit ihrem Latein am Ende sind: Ein Mann weint bitterlich. Seine geliebte Frau ist gestorben. Er saß lange am Bett der Verstorbenen, hat ihre Hand gehalten und konnte nichts tun. Diese Ohnmacht! Diese Hilflosigkeit! Diese Sinnlosigkeit! Diese Brutalität! Ob die liebenden Augen des selbst- und mitleidenden Gottes der Christen ihm Trost schenken können?
Die Gewissheit, in Gott geborgen zu bleiben, ist ein persönliches Geschenk des Himmels. Kein kluger Kopf kann das Vertrauen auf Gottes Neuschöpfung ersetzen oder gar schaffen, zwar verhöhnen oder ignorieren, aber auch nicht zerstören – mehr als ein gutes Gefühl.
Burkhard Budde