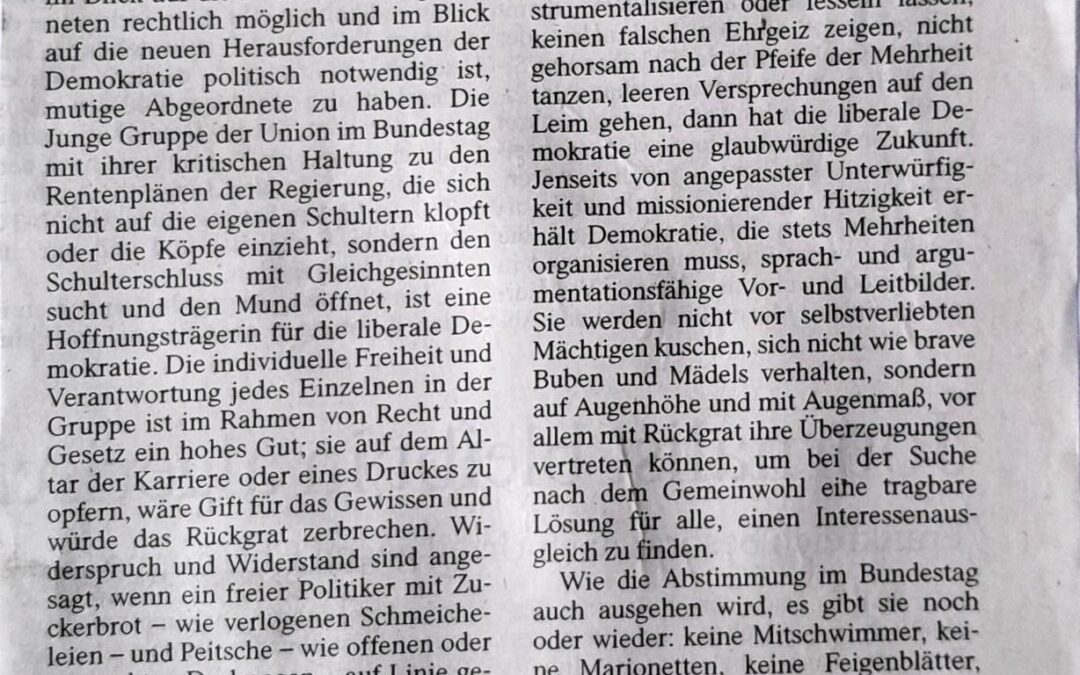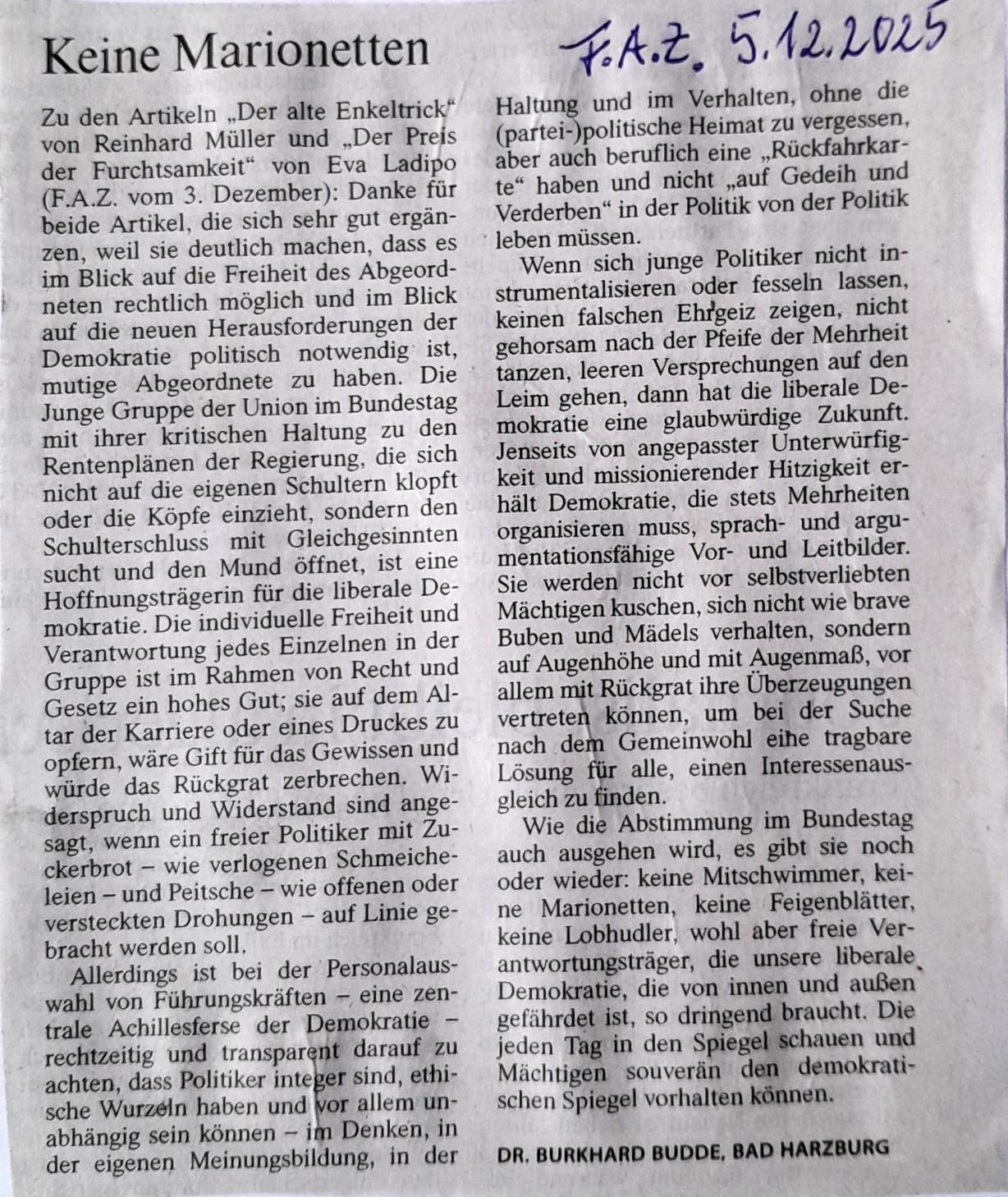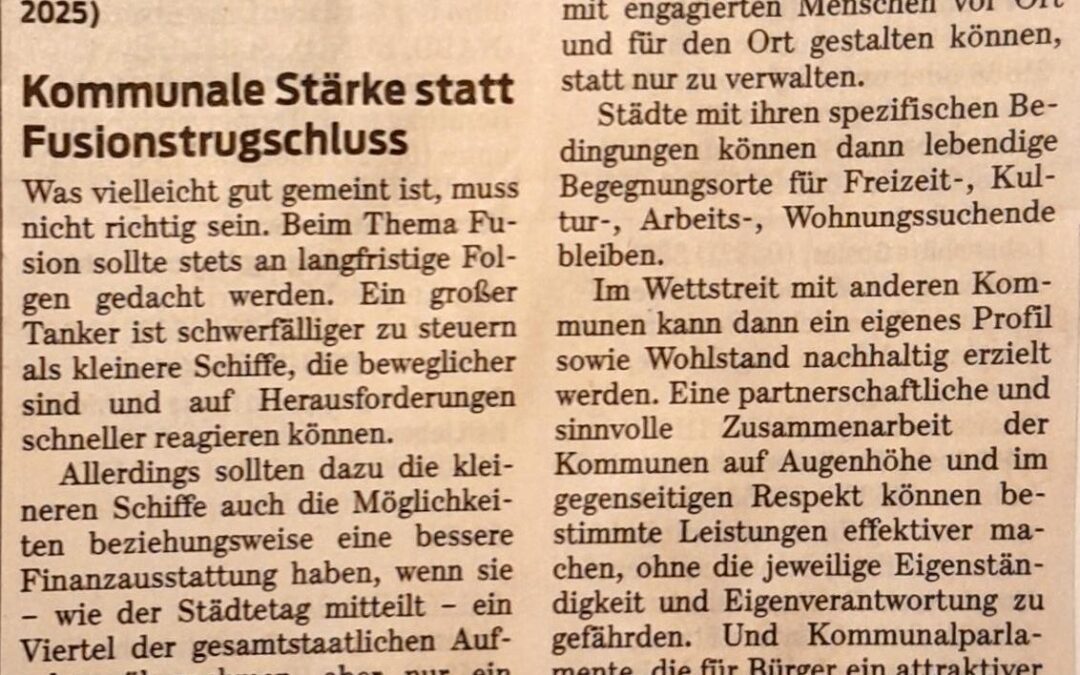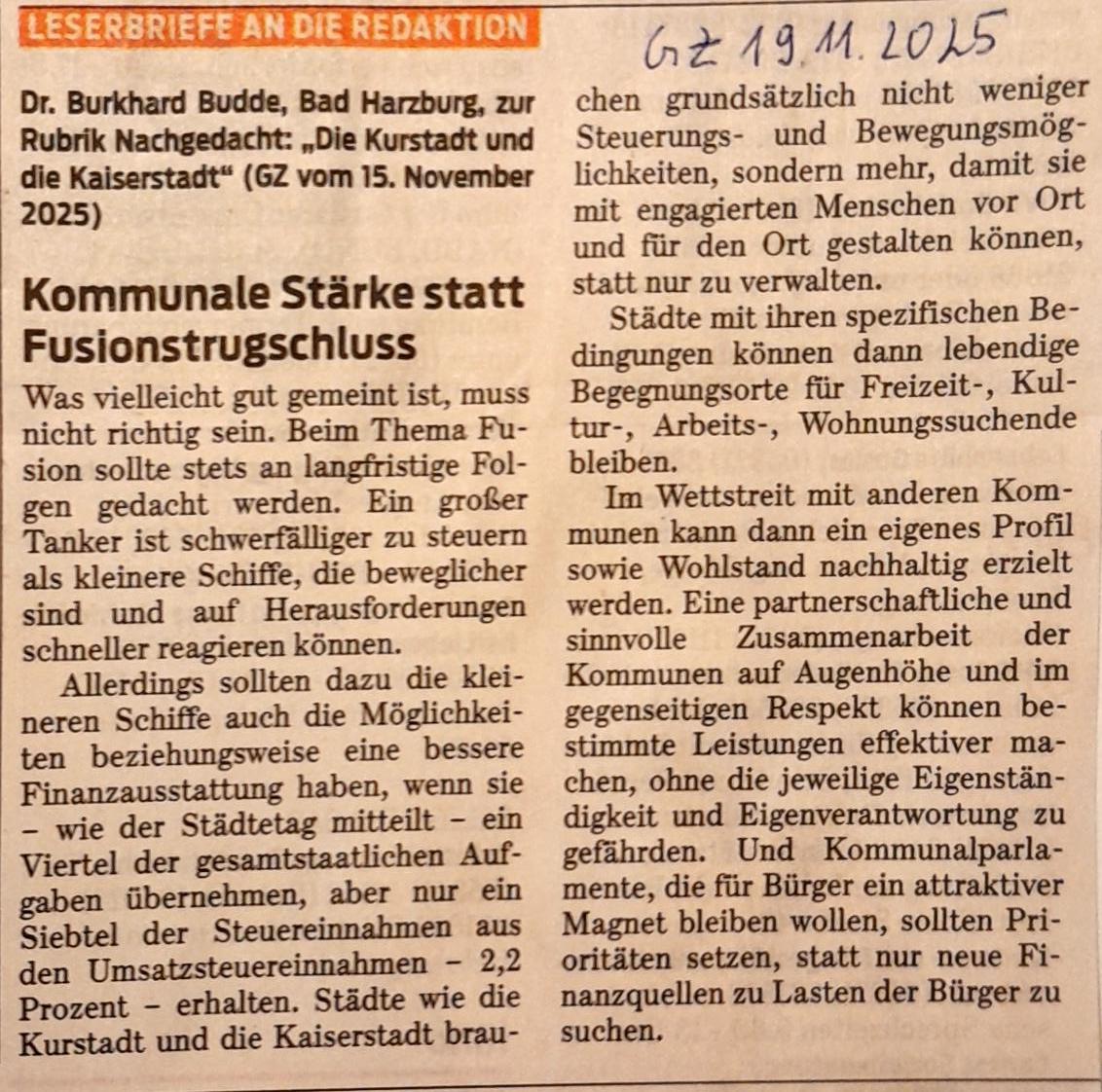Nikolaus
Zum Nikolaustag
Verkehrte Welt?
Von Burkhard Budde

Zum Nikolaustag
Verkehrte Welt?
Am Nikolaustag, am 6. Dezember, kann die Welt aus den Fugen geraten. Der „Nikolaus“ (griechisch „Sieger des Volkes“) provoziert „verkehrte Welt“. Er fragt, ohne gefragt zu sein, ob Menschen „brav und fromm“, barmherzig und gerecht, verantwortungsbewusst und vernünftig (gewesen) sind. Oder ob sie (weiter) zugeknöpft bleiben wollen, selbstgenügsam, selbstgerecht, selbstsüchtig und selbsterhöht.
Der alte Nikolaus mit seinem faltigen Gesicht und seiner tiefen Stimme, seinem Vollbart und seinem roten Mantel, seinem Sack, dem Notizbuch und der Rute ließ Kinder erschaudern und zittern. Und Erwachsene ängstlich schmunzeln.
Der neue Nikolaus ist anders. Er ist ein Sympathie- und Symbolträger allgemeiner Menschlichkeit und konkreter Nächstenliebe im Vertrauen auf Gottes überraschendes Wirken in allen Ungewissheiten. Er verkörpert Weisheit und Vernunft, persönliche Verantwortung im Rahmen des Möglichen und Nötigen. Er will anderen Menschen Freude bereiten und lädt sie zu einem menschlichen Blick- und Kurswechsel ein.
Wahrscheinlich ist der historische Nikolaus um das Jahr 270 in der Hafenstadt Myra in Kleinasien geboren. Er wurde Priester und Abt eines Klosters, pilgerte ins Heilige Land und wurde nach seiner Rückkehr Bischof. Während der Christenverfolgung des Kaisers Galerius um 310 wurde er gefoltert, blieb aber seinem Glauben treu.
Für Nikolaus wurden zwei politisch-kirchliche Weichenstellungen wichtig:
Das Toleranzedikt von Mailand durch den neuen Kaiser Konstantin im Jahre 313 ermöglichte völlige Religionsfreiheit und die Gleichberechtigung des Christentums und führte zur Abschaffung des heidnischen Staatskultes.
Das Konzil zu Nicäa im Jahre 325, zu dem der Kaiser 280 Bischöfe für neun Wochen in seinen Sommerpalast eingeladen hatte, verhinderte eine Spaltung der Kirche, indem der Kaiser das Ergebnis des Konzils zum Reichsgesetz erhob. Der Priester Arius hatte die Auffassung vertreten, dass Christus nicht ewig sei, da er von Gott nicht gezeugt, sondern nur geschaffen sei. Der orthodoxe Patriarch Athanasius war wie Nikolaus der Überzeugung, dass Christus „wesensgleich mit Gott“ sei – ein bis heute gültiges Glaubensbekenntnis.
Nach Myra zurückgekehrt, starb Nikolaus an einem 6. Dezember um das Jahr 342.
Seine Botschaft hat bleibende Bedeutung: Die „verkehrte Welt“ kann durch die Haltung des Glaubens und der Liebe, der Vernunft und Verantwortung gerade gerichtet werden. Man muss wohl dem Nikolaus nur im eigenen Herzen und in der eigenen Welt begegnen.
Burkhard Budde