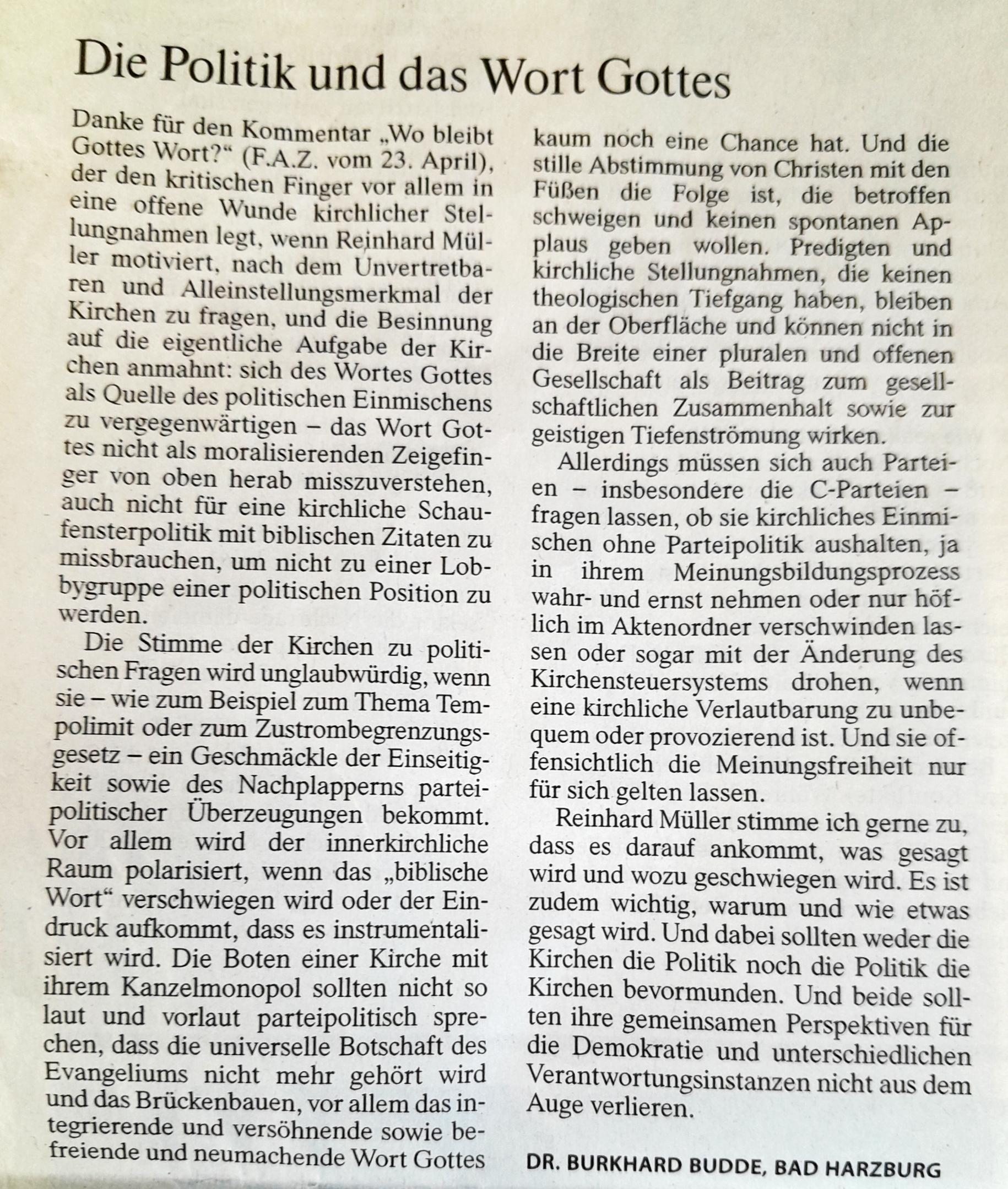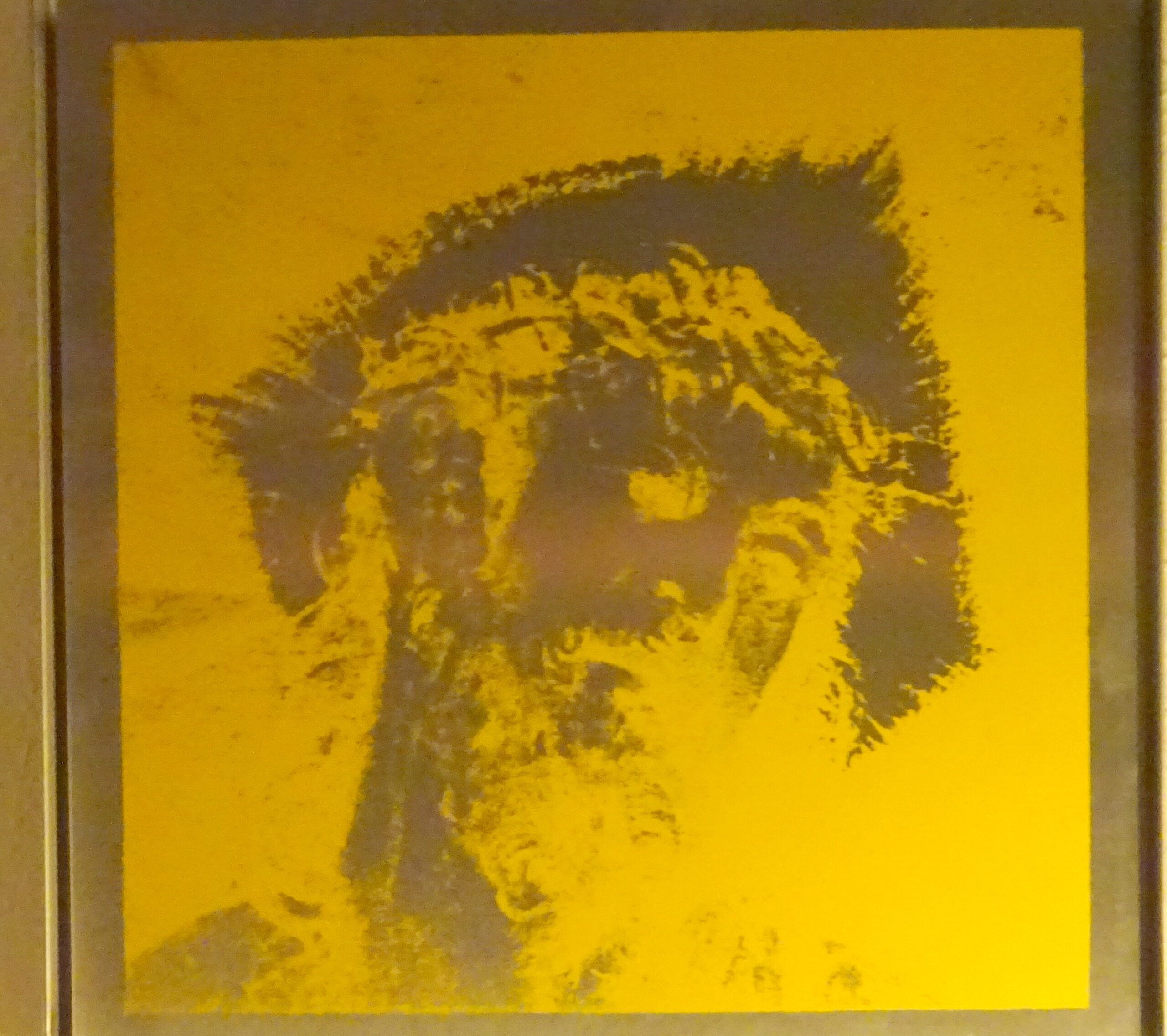Gute Gemeinschaft
Auf einWort
Suche gute Gemeinschaft
Von Burkhard Budde

Auf ein Wort
Suche gute Gemeinschaft
Es gibt manchmal gute Gründe, einer Gemeinschaft den Rücken zu kehren. Wenn zum Beispiel die „Chemie“ überhaupt nicht (mehr) stimmt und Änderungen nicht zu erwarten sind, Vertrauen zerstört wurde und Sinnhaftigkeit verloren gegangen ist und es tiefe Verletzungen gegeben hat, die auch die Zeit nicht einfach heilt. Und wenn Skandale und Missstände ein Ventil darstellen, endlich Dampf abzulassen und aus einer Gemeinschaft „auszutreten“.
Aber es gibt auch gute Gründe, zum Beispiel in einer christlichen Gemeinschaft „trotz allem“ zu bleiben oder in eine Kirche wieder einzutreten. Dazu zählen zum Beispiel die bereichernde Erfahrung einer geistig-geistlichen Heimat mit Gottesdiensten und Konzerten, die kirchliche Begleitung in besonderen Lebenssituationen durch Feiern wie Taufe, Trauung, Konfirmation, Beerdigung, die Halt und Orientierung, aber auch Mut und Trost geben können. Und vielen sind darüber hinaus die christliche Tradition- und Wertevermittlung an die nächste Generation wichtig sowie diakonische und caritative Aktivitäten und Einrichtungen.
Bei der Suche nach einer guten, stets gemischten Gemeinschaft der Gläubigen sollte auf keinen Fall der kritische Geist, der die Geister scheidet und unterscheidet, an der Garderobe einer Kirche abgelegt werden. Schon die Bibel empfiehlt „Prüfet alles und behaltet das Gute.“ (1.Thess. 5,21)
Die verfasste Kirche kann mit einem alten Heilbad verglichen werden, das ständig umgebaut und erweitert, verändert und erneuert worden ist und wird oder werden sollte. Nur sollten die Verantwortlichen dieser zu erneuernden Bäder, die keine Freizeit- oder Spaßbäder sind, nicht ihren eigentlichen, unverwechselbaren und unvertretbaren Auftrag vergessen, das „Wasser des Lebens“ – das Evangelium von Jesus Christus – in Wort und Tat zu verkündigen.
Reformer und ständige Reformen bleiben wichtig. Es reicht aber nicht, wenn Erneuerer am Beckenrand stehen bleiben, vor allem mit sich selbst und den Strukturen beschäftigt sind oder über die geschrumpfte Zahl der Besucher jammern, ohne zu merken, wie das Wasser im Becken – die geistige Substanz – immer weniger wird und sie selbst und andere eines Tages zu „verdursten“ drohen, wenn sie das „Gute“ aus dem Auge verlieren.
Das „Gute“ besteht nicht im eiskalten Wasser, das ins Becken gegossen wird, im unfairen, gehässigen, heuchlerischem Umgang untereinander; nicht im kochenden Wasser, das als heiße Luft verdampft, in politischer Besserwisserei oder im parteipolitischen Nachplappern; auch nicht im lauwarmen Wasser, das keine wirkliche Erfrischung bringt, in langweiligen Belanglosigkeiten oder Allerweltsweisheiten; in Wechselbädern, bei denen Besucher fragen „Wo ist denn nun das Wasser des Lebens?“
Das „Gute“, der Maßstab christlicher und kirchlicher Existenz, ist und bleibt der froh- und neumachende Glaube an das Evangelium von Jesus Christus, das in kirchlichen Heilbädern als Geschenk Gottes entdeckt werden kann.
Ein Tropfen von diesem lebendigen Wasser kann den Durst nach Sinn und Liebe, nach Versöhnung und Frieden stillen, so dass aus Besuchern Begeisterte werden, die ihre Verantwortung vor Gott und dem Nächsten, vor der Vergangenheit, der Mitwelt und Nachwelt mutig im Geiste Jesu Christi wahrnehmen – auch für ein „besseres“ Miteinander in allen anderen Bädern dieser Welt.
Burkhard Budde