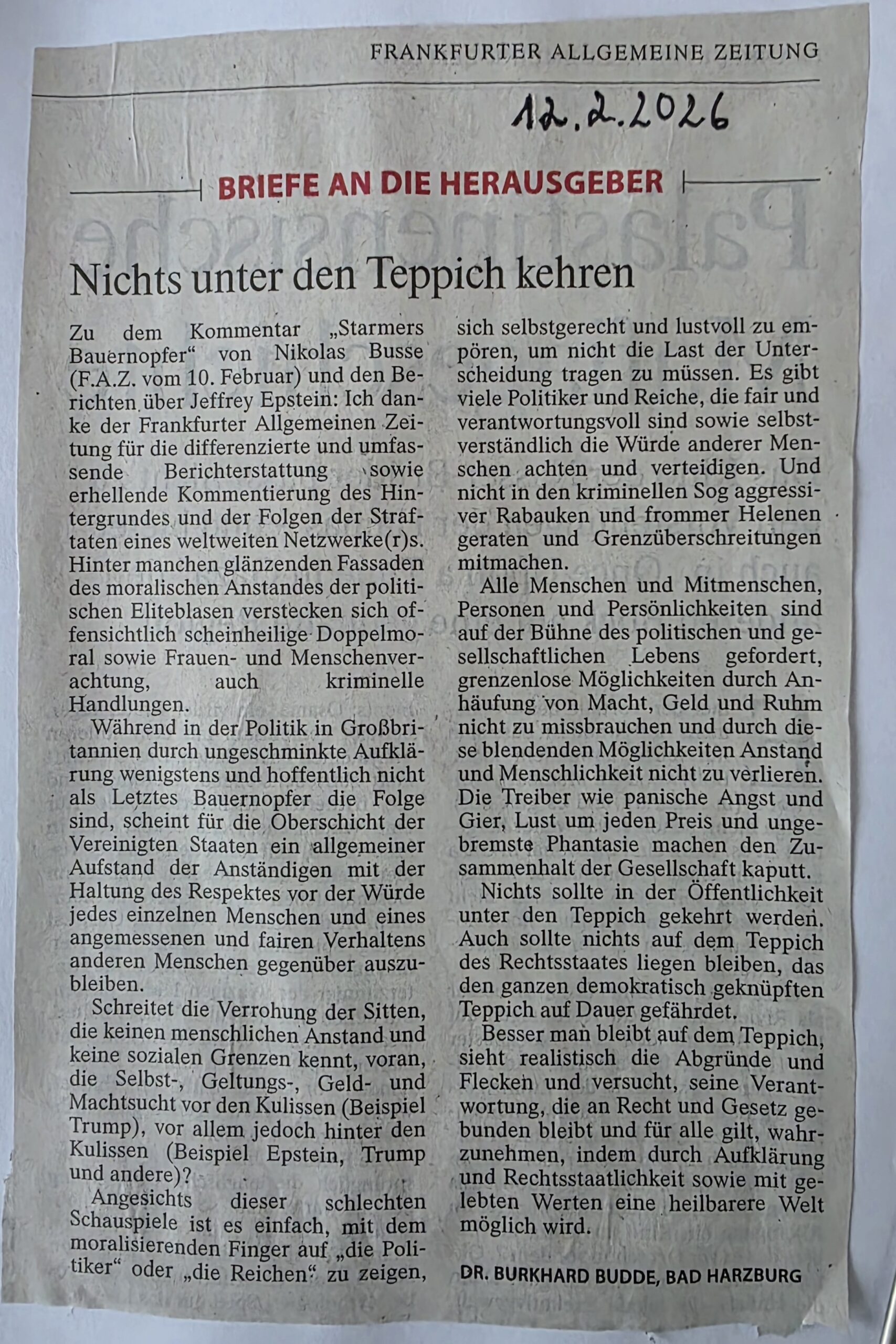Gegen Judenhass
75 Jahre Zentralrat der Juden
Gegen Judenhass
Von Burkhard Budde

Dr. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland
Oberbürgermeister: „Widerstand gegen Antisemitismus“
Die Realität dürfe nicht verleugnet werden, sagte Dr. Josef Schuster, der Antisemitismus habe bereits seinen Platz in der Gesellschaft genommen. Und „seit dem 7. Oktober spüren wir einen explosionsartigen Anstieg des Antisemitismus, berichtete der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland anlässlich der Eröffnung der Ausstellung „MIT EIGENER STIMME 75 Jahre Zentralrat der Juden in Deutschland“ am 22. Februar 2026 im Staatstheater Braunschweig.
Antisemitismus sei eine „Brückenideologie“: Rechtsextreme, Linksextreme und Islamisten seien alle Feinde der Demokratie. Der Einsatz für Anstand und demokratische Kultur ließe sich jedoch nicht politisch verordnen. Josef Schuster: „Es kommt auf jeden Einzelnen an.“
Zuvor hatte Braunschweigs Oberbürgermeister Dr. Thorsten Kornblum die Ausstellung eröffnet, die unterschiedliche Facetten jüdischen Lebens in Deutschland abbildet, das vielfältige Engagement jüdischer Institutionen zeigt sowie die Geschichte und das Wirken des Antisemitismus verdeutlicht. Der OB der „City of Lions“ forderte zum Widerstand gegen Antisemitismus auf, damit Juden „sicher, sichtbar und respektiert in Deutschland leben können.
Maria-Rosa Berghahn, die Direktorin Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, setzte sich in ihrer Rede für die Demokratie als Wertversprechen ein. Demokratie brauche Erinnerung „und Erinnerung braucht Institutionen, die sie tragen.“ Und Demokratie beginne dort“, wo wir Verantwortung übernehmen“, so Maria- Rosa Berghahn.
Weitere Reden gab es von Maria Bering, Ständige Vertretung des Leitenden Beamten bei dem Beauftragte der Bunderegierung für Kultur und Medien, Dr. Kai-Michael Sprenger, Direktor Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte, Dr. Peter Joch, Direktor Städtisches Museum Braunschweig, Fedor Besseler, Kurator der Ausstellung.
Den musikalischen Rahmen gestaltete Diana Goldberg & Band.
Die Ausstellung – bis zum 20. September 2026 – befindet sich im Haus am Löwenwall, Steintorwall 14.

Dr. Thorsten Kornblum, Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig

Den musikalischen Rahmen gestaltete Diana Goldberg mit ihrer Band