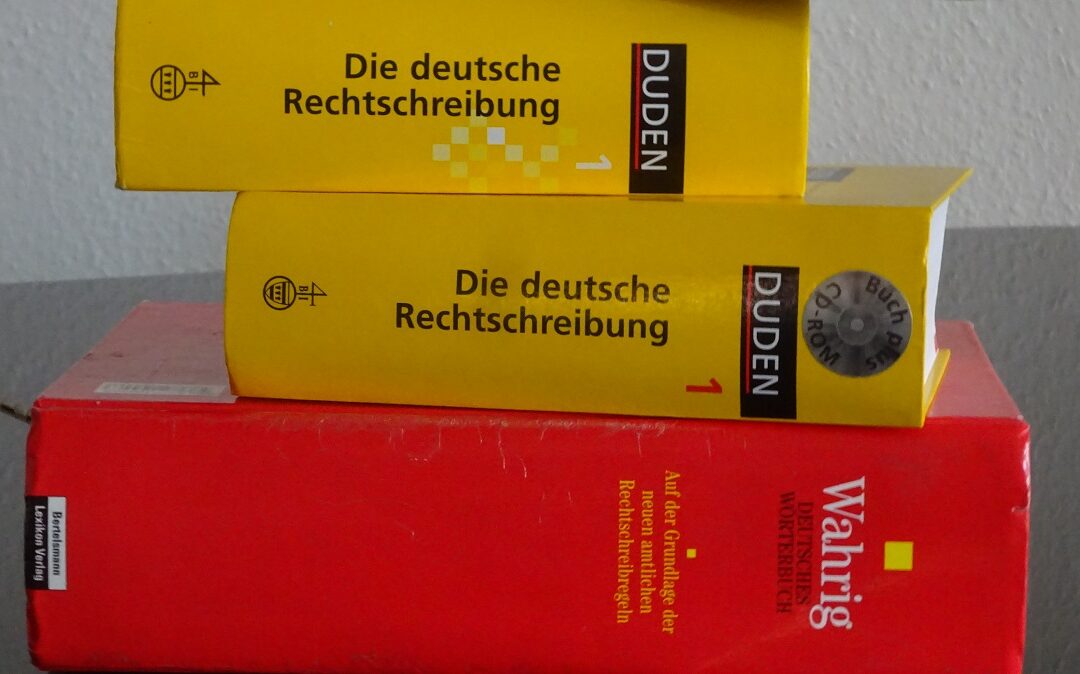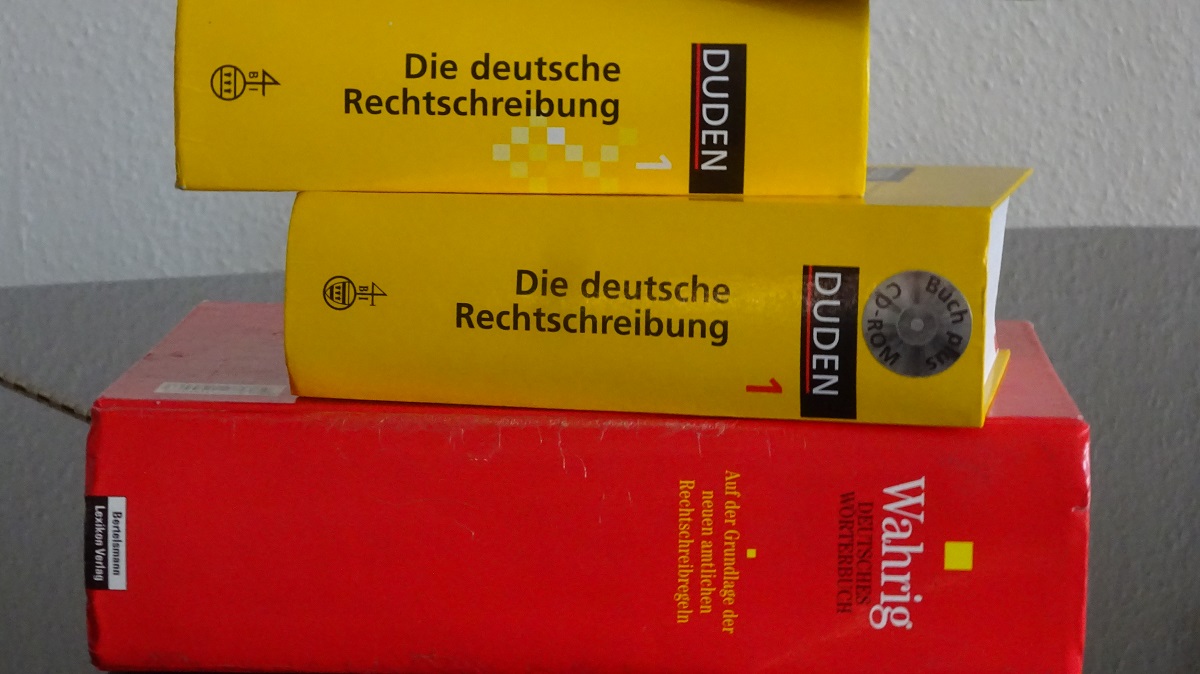Machtkampf
Moment mal
Machtkampf
Von Burkhard Budde

Ein Löwe symbolisiert Macht und Kraft.
Die Macht der Mächtigen
Wie mächtig sind Mächtige? Wer hat im Machtspiel das Sagen? Wer setzt sich wie durch? Wer bekommt den meisten Applaus?
Der König der Tiere – ein Löwe – beeindruckt durch Stärke. Wenn er brüllt, um seine Ansprüche hörbar zu machen, flößt er Ehrfurcht ein. Indem er Spuren seines Vorgängers gnadenlos zerstört, verbreitet er Angst und Schrecken. Um Beute zu machen, duckt er sich, pirscht sich an sein Opfer heran und wartet zum Sprung auf den richtigen Augenblick.
Der König des Waldes – ein Hirsch – punktet mit Kopfschmuck. Früher war er ein „Spießer“, jetzt zeigt er stolz sein prächtiges Geweih. Wenn er schreit, um sein Revier abzugrenzen und Nebenbuhler zu vertreiben, fordert er gleichzeitig blinde Gefolgschaft von seinem Gefolge. Er bleibt jedoch scheu und versteckt seine eigentlichen Absichten lieber im Dickicht.
Der König der Lüfte – ein Adler – fasziniert durch Flugkünste. Elegant schraubt er sich in die Höhe und zieht majestätisch seine Kreise. Wenn er mit seinen messerscharfen Augen blickt, ist Vorsicht geboten. Mit scharfen Klauen jagt er seine Beute, um sie zu vernichten. Er fühlt sich wie ein Mittler zwischen Himmel und Erde, unverwundbar und unerreichbar.
Der König der Meere – ein Hai – lässt den Atem stocken, wenn er auftaucht. In der Tiefe und Weite des Meeres bewegt er sich mit großer Schnelligkeit. Er hat sich angepasst und spezialisiert. In einer Begegnung mit ihm mischen sich pure Faszination und panische Furcht.
Der König der Könige – ein Mensch – ist ein Mischwesen. Seine unantastbare Würde verliert er nicht. Selbst in wilden Stürmen des Lebens kann er vernünftig und verantwortungsbewusst bleiben. Aber im unbändigen Streben nach Macht um jeden Preis ist Scheitern vorprogrammiert: Als Löwe im Kampf um immer größere Beute zahnlos zu enden. Als Hirsch im Dickicht der sich ausbreitenden Grauzonen entdeckt zu werden. Als Adler auf der Höhe seiner Macht ohne Bodenhaftung abzustürzen. Als Hai in der Tiefe seines Kampfes ohne Selbstkritik zum Gejagten zu werden.
Muss ein Machtmensch so enden? Ein Mensch muss kein Gutmensch werden. Aber er kann mutig und zugleich demütig sein, heiter gelassen und zugleich vernünftig besonnen, eigenverantwortlich und zugleich rücksichtsvoll.
Manche gehen vor Gott auf die Knie, der Menschen selbst in ihrer Ohnmacht Kraft und Zuversicht schenkt, indem er sie aufrichtet, damit sie aufrecht gehen und auf Augenhöhe mit „Königen“ stehen können. Sie wissen: Macht ist nötig, um gestalten, steuern und führen zu können; dass sie jedoch vorläufig, zerbrechlich und vergänglich bleibt. Macht braucht Legitimation und Kontrolle; ist in der liberalen Demokratie stets verliehene Verantwortung auf Zeit – im Bewusstsein „vor Gott und den Menschen“(Grundgesetz).
Burkhard Budde
Veröffentlicht im Westfalen-Blatt in Ostwestfalen und Lippe
am 17.4.2021 in der Rubrik Moment mal